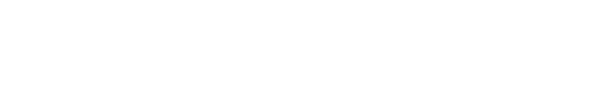Auseinandergelebt?
Alte Bündnisse, neue Verortungen und andere Umbrüche in der Erinnerungskultur.
(Persönliche) Randbeobachtungen zu den Debatten
von Anja Siegemund.
Mein damaliger »Magistervater«, Ordinarius an der Universität München, zitierte einst in einer Sprechstunde einen anderen Professor, der auf einem Panel seine Argumentation wie folgt begonnen hatte: »Ich als Jude … «. Mein Magistervater fand eine solche Einleitung unhaltbar, denn seit der Aufklärung wüssten wir doch, dass eine Wahrheit eine Wahrheit ist, egal wer sie sagt. Diese Aussage hat sich mir als Studentin eingekerbt, tatsächlich habe ich in all den Jahren diese Sprechstunde nicht vergessen, vielleicht war ich zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert. Bis heute treibt sie mich um, immer wieder. Widersprochen habe ich nicht und bis heute glaube ich, dass das Konzept der Unabhängigkeit des Inhalts vom »Wer« ein hoch zu haltendes Gut ist, das nicht zuletzt wesentlich einen Rechtsstaat prägt; allerdings ist die reflektierte Sprecherposition auch Teil dieser Realität. Heute würde ich ihm entgegenhalten, dass individuelle Kontexte mit der Formulierung von Inhalten verwoben sind. Beide Gedanken sind berechtigt, stehen oft im Konkurrenzverhältnis, sie reiben sich, sollten stets miteinander gedacht werden.
Das Ringen um Erinnerungskultur begleiten die Fragen rund um das individuelle und gruppenbezogene »Wer«: Wer spricht, aus welcher Position, welche Rolle wird zugeschrieben, und was sind jüdische Perspektiven? Welche alten und neuen Bündnisse in der Erinnerungskultur gibt es?
Spaltungen
Das konfliktträchtige Thema ist, welche Position die Schoa zukünftig im Gesamtgefüge der Erinnerungskulturen einnehmen, welcher anderen (Menschheits)Verbrechen und Opfergruppen wie gedacht werden soll. Darüber sind Konflikte fast wie Brandherde aufgeflackert. Bedenklich ist, dass schon die Erwähnung mancher Termini, der Namen von Kombattanten oder auch von Institutionen, die quasi einschlägig identifiziert werden, schnell wie negative Codewörter wirken. Dabei bildet die Art des Diskurses mitunter den Kontext einer Gesellschaft ab, in der die Regeln der guten Debatte – Zuhören und Abwägen – zu wenig gelten. Dass allerdings nach wie vor Einigkeit besteht, wenn es um eine Abgrenzung zu revisionistischer Geschichtsauslegung geht, ist so selbstverständlich, dass ich mich auf andere Diskursteilnehmende grundsätzlich nicht beziehe. Doch auch innerhalb des relevanten Spektrums sind die Gräben tief, die Friktionen hochemotional, Arbeitsbeziehungen brechen auseinander. Welche Dimension die Konflikte erreicht haben, zeigen die Wahrnehmungen davon, wer zum »eigenen« und wer zum »anderen« »Lager« gehört, was sich in der Einladungspraxis spiegelt: Warum finden die Podien und Konferenzen fast immer innerhalb der eigenen »In-Group« statt? Besonders schädlich ist, dass die Diskurse um Erinnerungskultur explizit oder implizit mit parallelen Debatten verknüpft und aufgeladen werden: mit der Definition von Antisemitismus, mit israelischer und palästinensischer Politik sowie der Diskussion um den BDS. Statt bei bestimmten Positionen automatisch Instrumentalisierungen, Funktionalisierungen und Kalkül anzunehmen, und auch statt jeglichem Whataboutism ist eher ein kompliziertes und anstrengendes Auseinanderhalten nötig, um reflexartige Reaktionen im Zaun zu halten. Vielleicht sollten die Erkenntnisse der Konfliktforschung berücksichtigt werden: nicht alles mit allem verhandeln und damit Feuer schüren.
Rückblick – auf die gute alte Zeit?
Um die Umbrüche zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Jahre und Jahrzehnte zuvor: War alles anders? Die Solidaritäten und Verbündeten waren doch eindeutig? Da gab es doch eine klare Haltung in Bezug auf die Notwendigkeiten der Geschichtsvermittlung und Aufklärung, der Einrichtung von Gedenkstätten, der Sichtbarkeit von ehemals Verfolgten im Stadtraum? Aufdecken statt zudecken, Verantwortung einfordern und Kontinuitäten der Nazi-Ideologie und des -Personals benennen. Ein progressiver Teil der Gesellschaft, Opfergruppen inklusive Jüdinnen und Juden fast gleich welcher weltanschaulicher Couleur, zog an einem Strang, war sich erinnerungspolitisch weitgehend einig. Oder? Aus meiner Sicht zumindest sah die Welt damals mehr oder weniger so aus, ich bin so sozialisiert – in wohltuender Übersichtlichkeit. Vielleicht war auch das Gegenüber definierter: die geschichtspolitisch Konservativen, die Gegner der Wehrmachtsausstellung, die Schlussstrich-Anhänger. Aber es sollte hier nichts überzeichnet ·werden, innerhalb des progressiven Spektrums herrschte keineswegs nur Harmonie. Das Beispiel der Gedenkstätte Dachau erlebte ich aus relativer Nähe mit. Hier brach die Front darüber auf, für wen Gedenkstätten sein und wie sie erzählen sollen. Als sich An fang/Mitte der 199oer Jahre Initiativen für die Umgestaltung der Gedenkstätte zu einem moderneren Lernort engagierten, traf dies keineswegs auf ungeteilte Zustimmung. So hatte die Leitung der Gedenkstätte die Sensibilitäten und Wünsche der Überlebenden genau im Blick. Den nun alten Menschen, die das KZ überlebt hatten, fiel die Veränderung einer Gedenkstätte schwer, die sie selbst gestaltet hatten, auch der jahrelange Kampf wirkte nach. Ich selbst war damals, als junge Studentin und Honorarguide ein Teil von denen, die Veränderung für unabdingbar hielten, die von der SS gefertigte Fotos und Schautafeln ohne genügende Kontextualisierung als völlig deplatziert und überhaupt die Gestaltung als ungeeignet für einen Lernort hielten. Die Bedenken der ehemaligen Häftlinge konnte ich nur zum Teil nachvollziehen angesichts eines Ziels, das ihnen doch wichtig sein musste: die Aussage der Gedenkstätte für die folgenden Generationen begreifbar zu machen.
Im Nachhinein betrachtet: Ja, die Umgestaltung der Gedenkstätte war ein richtiger Schritt. Aber wie sehr begriff ich die Kontexte von derartigen Prozessen und die Empfindungen jener, ohne deren Kraftanstrengung gegen viele Widerstände die Gedenkstätte 1965 gar nicht eingerichtet worden wäre, wie viele Gedanken machte ich mir über sie als legitime Player? Lange waren sie und andere Opfervereinigungen relativ allein mit ihrem Erinnern, Gedenken, Mahnen gewesen; viele Jahre dominierte noch das Erinnern, das der jeweilige deutsche Staat privilegierte. Weder wurde in größerem Maße der jüdischen Opfer gedacht noch gehörte selbstkritische Reflexion über den Nationalsozialismus zum Mainstream. Und noch schrieben nur in wenigen Fällen Nichtjuden über die Schoa (geschweige über die Perspektiven der Opfer) oder über jüdische Geschichte, so wie auch die Leo Baeck Institute zunächst nur jüdische Wissenschaftler:innen versammelten, wobei dies eine jahrhundertelange Praxis abbildete: jüdische Geschichte schrieben stets vor allem Juden und (wenige) Jüdinnen. Die 68er interessierten sich dann eher für die Verbrechen und das Wegschauen ihrer (Groß)Elterngeneration. In der Bundesrepublik führte erst ab den 197oer und 198oer Jahren das bürgerschaftliche Engagement der »Geschichte von unten«-Bewegung, der Initiativen zu Gedenkstätten zu einen revolutionierenden Effekt, der einen breiteren gesellschaftlichen Nonsens erzeugte. Dies spiegelte Demokratisierungsprozesse, die durch die kritischen Erinnerungsdiskurse angeschoben wurden. Über all dies gibt es meines Erachtens kaum Differenzen mit jenen, die vor allem seit den 1980er Jahren die Erinnerungskultur in Gedenkstätten, Wissenschaft und Museen vorantrieben. Viele engagierte Menschen – ich betone: die meisten Nichtjüdinnen/-juden, zunehmend auch aus der ehemaligen DDR- nahmen sich dem an. Bündnisse entstanden: Ein spezifisch »jüdisches« Erinnern, ein Erinnern für Jüdinnen und Juden, aber auch universales Gedenken, etwa für Menschenrechte und eine neue Gesellschaft, fanden zusammen. Das Ziel war kongruent genug, so dass es die Feinheiten darunter oder auch die Mixturen an Motiven überdeckte. In einem Zeitfenster zwischen Ende der 198oer bis in die 2oooer Jahre verwoben sich in puncto Erinnerung also Partikularismus und Universalismus, wobei hier keine essenzialistische Zuschreibung vorgenommen werden sollte: Die Gegensätze verliefen nicht unbedingt entlang der Linie Jüdisch/Nichtjüdisch.
Manche werden einwerfen, dass ein solches Bündnis gar nicht bestand, und etwa die Verwerfungen Mitte der 198oer Jahre um das Fassbinder-Stück »Die Stadt, der Müll und der Tod« ins Feld führen, bei dem die Meinungen auseinandergingen, ob hier Antisemitismus reproduziert oder aber dekonstruiert wurde. Damals war die Besetzung der Theaterbühne vor allem durch Jüdinnen/Juden ein Akt jüdischer Selbstermächtigung und in dieser Art ein Novum. Diese Jüdinnen/Juden lasen das Stück aus ihren Perspektiven, die man hier wohl jüdische nennen kann. Das war für manche schwierig und doch wurde das Bündnis bestärkt durch die rechten Schatten, für die die Auslassungen Martin Walsers über die »Moralkeule« Auschwitz nur ein Beispiel waren. Sich dem entgegenzuwerfen, war keine Frage und schuf Einigkeit, ebenso wie der Historikerstreit Ende der 198oer Jahre. Er führte dann zu intensiveren Forschungen zur Schoa, zu vergleichender Forschung zu Genozid und Gewaltgeschehen, allerdings mit relativ wenig Echo in der Gesamtgesellschaft.
Das Setting heute. Erinnerungskultur – Synonym für staatlich, etabliert und jüdisch?
Heute ist das einst gar nicht Etablierte nun staatlicherseits institutionalisiert, normativer und öffentlicher Mainstream: ein wertebasiertes Gedenken, das stark opfer- (und kaum täter) zentriert ist und tatsächlich besonders stark die sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden im Blick hat (und insbesondere die Deutschen unter ihnen). Diese >Verstaatlichung< der Erinnerungspolitik², was die Schoa betrifft, hat Bündnisse von politisch links stehen den Menschen mit anderen Opfergruppen verstärkt. Man mag überlegen, ob auch deswegen bei manchen das (uneingestandene?) Gefühl aufkam, Jüdinnen und Juden wären nun als Teil eines staatlichen Establishments weniger auf Solidarität angewiesen. Doch unter der Schutzdecke der vermeintlich staatstragenden Etabliertheit ist das gesellschaftliche Gesamtbild ein anderes. Denn insgesamt sind die Errungenschaften der Erinnerungskultur weder in Bezug auf intellektuelle Kreise noch die breitere Gesamtgesellschaft ein selbstverständliches Given. Diese Feststellung sollte nicht zum Gähnen veranlassen. Die folgenden Befunde dürften allen Diskursteilnehmenden vertraut sein und ich gehe davon aus, dass sie genauso ernst genommen werden. So sind Tendenzen, die Opfererzählungen zu nivellieren, nicht passe, es gibt immer wieder ein Aufbäumen des Narrativs, allen »Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft« gleichermaßen zu gedenken, wie es der Schriftzug in der Neuen Wache in Berlin formuliert. Vor allem regional sticht immer noch die entsprechende Semantik hervor, etwa wenn in Ortsgeschichten die Zeit von 1933 bis 1945 unter »die schwierigen Kriegsjahre« subsumiert wird. Oder folgendes, willkürliches Beispiel der Verdrängung: Während ich an diesem Artikel schreibe, fällt mir das gerade publizierte Buch des Journalisten Alois Berger in die Hände. Berger stammt aus dem bayerischen Wolfratshausen und verbrachte seine Jugend neben jenem Stadtteil, in dem von 1945 bis 1957 das jüdische DP Lager Föhrenwald existierte. Von dessen Geschichte, davon, dass da Überlebende direkt neben der deutschen Bevölkerung gelebt hatten, erfuhr er selbst erst vor wenigen Jahren. Sein Erschrecken über das jahrelange Verbergen und die »gemeinsame Entschlossenheit einer ganzen Generation, zu schweigen«, kann ich umso mehr nachvollziehen, als die jüdische Geschichte Wolfratshausens schon seit Jahrzehnten erforscht ist. Es bringt zum Nachdenken, welche Gräben zwischen der Forschung einerseits und dem Bewusstsein von vielen andererseits nach wie vor existieren. Wem dies zu eklektisch ist: Eine Aufspaltung zwischen einer als »offiziell« wahrgenommenen Erinnerungskultur und anderen Familienerzählungen ist nachgewiesen. Seit zwanzig Jahren weiß man, dass in vielen Familien die Themen Krieg und Gefangenschaft an die nächsten Generationen tradiert werden: Familiengedächtnisse als Parallelinitiative. Vor zehn Jahren lieferte der Fernseh-Dreiteiler »Unsere Mütter, unsere Väter« der Erzählung »Opa war kein Nazi«⁴ Identifikationsfiguren; diverse Studien der letzten Jahre bestätigen, zumindest zum Teil, die Virulenz dieser Narrative. Ein nicht geringer Teil benennt nicht konkret Jüdinnen und Juden als Opfergruppe; insbesondere in Bezug auf die eigenen Vor fahren ist das Bild verzerrt: Ein Wissen um Opfer- und Helferschaft in der eigenen Familie wird stark, um Täterschaft oder Mitläufertum vergleichsweise wenig tradiert. Man mag hierin einen nachvollziehbaren apologetischen Mechanismus sehen: Wer wollte schon, dass seine Familie Teil des nationalsozialistischen Räderwerks war? Laut einer jüngeren Studie setzt fast ein Fünftel der Befragten das Leid der verfolgten Opfergruppen mit dem der deutschen Bevölkerung gleich – wenig überraschend, blickt man auf den Erfolg der Rechten und Rechtsextremen. Zusammengefasst: Wenn heute nicht mehr als nur eine knappe Mehrheit sich dagegen wendet, einen »Schlussstrich<< unter die NS-Vergangenheit zu ziehen – gegenüber einem Viertel Zustimmung und einem knappen Fünftel in einer Zwischenposition–, so sollte dies nach Jahrzehnten der Vermittlung von Wissen und Werten keine beruhigende Zahl sein.
Auch deswegen ist jene Etabliertheit des Gedenkens an die Schoa nicht lapidar, selbst wenn ihr Gedenken zu formelhaft sein mag, zu oft auf ein hilfloses »Nie Wieder« rekurriert. Sogar wenn sie, wie Y. Michal Bodemann schon 1996 feststellte, ein »Gedächtnistheater«⁵ ist, das feste binäre Rollen von jüdisch und nichtjüdisch festlegt, oder wenn sie ein »Versöhnungstheater«⁶ ist, das um der eigenen Läuterung wegen die »Wiedergutwerdung der Deutschen«⁷ inszeniert. Denn alles geschieht in einem Kontext, in dem die Bedeutung der Erinnerung an die Schoa keineswegs ein abgesicherter Glaube ist. Erinnerungsarbeiter:innen, deren täglich Brot dies ist und die unmittelbar auf die Reaktionen der Men schen treffen, können eine solche Betonung vielleicht eher nachvollziehen als Historiker:innen. Jedenfalls ist die Argumentation Samuel Salzborns, in Deutschland sei jenseits der offiziellen Rituale eine breite Mehrheit eher mit »Erinnerungsabwehr«⁸ beschäftigt gewesen, zwar zu pauschal, aber nicht aus der Luft gegriffen. In dieser Situation findet statt, dass einige das Bündnis der Erinnerung eindeutig aufkündigen – so eine Perspektive, innerhalb und außerhalb der jüdischen Community. Gräben, die sich schon vorher zeigten, klaffen nun vollends auseinander, angefeuert von einigen Debattenbeiträgen und manch unsäglicher Semantik: um ein Festhalten an der These der Singularität der Schoa, was als falsch gesehen wird, um eine Instrumentalisierung der Schoa und die Überhöhung der Erinnerung an sie zu einer Religion, zumindest einer Staatsräson, an der nicht gerüttelt werden dürfe, bei einem Kleinhalten der Kolonial oder anderer Verbrechen. Nicht alle Argumentationen tauchen so extrem und in dieser Geballtheit auf, manche nehmen auch die Gefahr einer Relativierung der Schoa ernst.
Pluralisierung und Sprecher:innenpositionen
Parallel behaupten sich Forderungen nach mehr Raum und Stimme im kollektiven Gedächtnis für bisher marginalisierte Erinnerungen. Die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse um den Anspruch der »Diversität«, um Teilhabe an Diskursen, politischer Gestaltungsmöglichkeit und an Ressourcen wirken tief in die Fragen der Erinnerungskultur hinein. Emanzipatorische identity politics sollte dabei kein Gegensatz zu aufklärerischem Denken sein: Mit Selbstermächtigung als Inhalt steht sie dafür, allen Menschen ihre Freiheit im Denken und Handeln zu geben, nur zweifelt sie an der Irrelevanz des »Wer«. Dieser Anspruch nach Selbstrepräsentation wird heute auch innerhalb der jüdischen Community nochmals stärker formuliert. Neue Generationen treten vor, sind selbstbewusst und fordernd. Da ist eine andere Lautstärke, aber auch eine andere Zahl an Jüdinnen und Juden. Ihr Empowerment versteht sich vielfach nicht als partikular, sondern als dezidiert emanzipatorisch. Sie erobern für sich Sprecher:innenpositionen, Orte in Kunst, Kultur und Bildung, nehmen Plätze ein in der Erforschung jüdischer Geschichte und Gegenwart. Damit geht eine andere Verschiebung ein her: der Raum, den Nichtjüdinnen/-juden zuvor einnahmen, wird vielfach in Frage gestellt.
Gleichzeitig bahnen sich mit der Auffächerung in verschiedene, mitunter divergierende Hintergründe und »Judentümer« auch innerhalb der jüdischen Community Umbrüche in ihrer Erinnerungskultur an, unterschiedliche Familienbiografien und Weltanschauungen bilden sich ab. Denn die Nachkommen jener. Jüdinnen/Juden, die seit der Nachkriegszeit die jüdischen Gemeinden in West und Ost dominierten, machen nur noch einen kleinen Prozentsatz aus. Die absolute Mehrheit sind postsowjetische Migrant:innen und ihre Nachkommen, hinzu kommt eine etablierte israelische Community und Jüdinnen/Juden aus anderen Teilen der Welt. Zwar sind die Gedenktage, die die Gemeinden zentral mit Grußworten von Politiker:innen begehen, vor allem nach wie vor der 9. November sowie der israelische Jom HaSchoa. Das (post)sowjetische Erinnern der Gemeinden als und für Soldat:innen der Roten Armee bedeutet zwar (wichtige) Anerkennung, ist aber wenig öffentlich, doch es weist den Weg. Im Sinne einer Spiegelung innerjüdischer Pluralität und Sichtbarmachung von solchen anderen jüdischen Erinnerungserzählungen war es daher wichtig, in unserer Berliner Version der Hohenemser/Flossenbürger Wechselausstellung »Ende der Zeitzeugenschaft?« Überlebende der Schoa mit heterogenen Erfahrungen zu Wort kommen zu lassen: jene, die aus Berlin stammen, sowie jene, die erst nach 1945 in Berlin lebten. Als heutige Berliner Jüdinnen/ Juden erhielten Menschen mit unterschiedlichen Geburtsorten und diverse Familienerzählungen eine Stimme: aus West-Berlin und Ost-Berlin, aus Israel und Frankfurt am Main, aus Moskau und Tadschikistan.
Pluralität der Jüdischen wie nichtjüdischen Stimmen und Deutungshoheit waren auch Kernfragen unserer Wechselausstellung mein jüdisches Berlin erzählen. Mein, Euer, Unser?«, die zum Teil durch den Aufruf »Und was ist Ihr jüdisches Berlin?« entstand. Ein repräsentatives Bild der jüdischen Community Berlins in Geschichte und/ oder Gegen wart sollte sich dadurch nicht ergeben; das Konzept war, persönliche »Beziehungsgeschichten« und Bindungen zu zeigen. Bewusst wurden als Protagonist:innen jüdische wie nicht jüdische Berliner:innen mit diversen Geburtsorten ausgewählt; dahinter stand die Überlegung, zu zeigen, dass viele Menschen einen Bezug zu (Berliner) jüdischer Geschichte haben. Sicher ist, dass die Auswahl des »Wer« weiter ein sensibles Thema nach allen Seiten bleiben wird. So gab mir nach der Gesprächsrunde »Alle reden von Vielfalt – Wie leben wir sie?« ein langjähriges Mitglied der jüdischen Community das Feedback, dass zu wenig von der spezifischen Berliner Geschichte geredet worden sei, was kein Wunder wäre, schließlich habe sich auf dem Podium niemand befunden, die/ der diese wirklich über Jahrzehnte hinweg miterlebt hatte.
Zuschreibungen und Selbstverortungen
Antisemitisch wird es, wenn in radikaler postkolonialer Theorie »die Juden« als »die Weißen« bezeichnet werden, was als Synonym für Rassismus und >>Privilegien<< gilt und mit entsprechenden Ressentiments aufgeladen ist. Verlängert man dieses binäre Weltbild in Bezug auf Erinnerung, so ergibt sich die Fiktion vom Judentum als Agent einer Erinnerungskultur, die die Unterdrückung Anderer fortschreiben wird. Solches konterkariert freilich – nicht nur! – schon die Tatsache, dass Jüdinnen/ Juden sich in den erinnerungskulturellen Debatten an verschiedenen Orten des Spektrums befinden, mit vielen Verästelungen. Es gibt nicht die eine jüdische Perspektive, was zu essenzialistisch gedacht wäre, es gibt auch hier kein Binär jüdisch-nichtjüdisch, sondern bei allen Menschen komplexe Melangen diverser Parameter, die ihr >>Wer<< ausmachen. So argumentiert eine Minderheit, gerade aufgrund ihres Jüdisch-Seins Universalismus besonders hochzuhalten, und kritisiert daher eine Erinnerungskultur, die die Schoa zu sehr im Zentrum hätte; teils schließt sie sich dem Vorwurf ihrer Instrumentalisierung an. Gerade einige jüdische Israelis und Israelinnen, zumal in Deutschland, sind dabei Vorreiter:innen – und damit für manche in der jüdischen Community Störfaktoren, nicht weniger aber für den deutschen Diskurs, dessen Grenzen sie überschreiten, denn »sie brechen aus der erwarteten Performance von Jüdinnen und Juden aus«.⁹ Diese innerjüdischen Gegensätze sind da und nicht so einfach auflösbar. Würde es nicht alles – auch für den deutschen Diskurs – erleichtern, könnte man die Auflösung eines Wer in puncto Erinnerung erreichen? Nein, und gleichzeitig ist auch der Anspruch, vermeintlich zu partikulare Perspektiven abzuschaffen bzw. nicht mehr entsprechend zu argumentieren – ein Anspruch, der meines Erachtens von manchen an die jüdische Mehrheit (unausgesprochen?) erhoben wird -, inakzeptabel. Auch diese Perspektiven sind Teil einer Selbstbehauptung, deren Legitimität prinzipiell für alle gilt.
(Ein) Kompass einer integrativen Erinnerungskultur
Als nötigen Layer für die Zukunft kann ich mir nichts anderes als Folgendes vorstellen – viele andere wiederholend: dass die Schoa in Deutschland für jede Generation immer wieder neu als das Menschheitsverbrechen erinnert wird. Dies ist eine Errungenschaft, die nicht über Bord geworfen werden darf, selbst wenn sie nicht durchgängig die wünschenswerte Breitenwirkung entfaltet. Obwohl ich auch Erinnerung an die Menschen an sich als wertvoll und wichtig finde, ohne gesellschaftliche Funktion, so gibt es diese zweifellos: Erinnern um eines Wertefundaments willen. Und selbst wenn ein solches Fundament sich theoretisch aus anderen Quellen speisen kann: Erinnern an die Schoa hat eine besondere Bedeutung, auch wenn viele weitere Erinnerung hinzukommt. Sie ist Kernkomponente der Sozialisation der Gesellschaft, von vielen Einzelnen, auch meiner. Ich verhehle nicht, dass mein Blickwinkel aus (meiner) Erinnerungskultur rührt – und sich weniger auf die Historiografie beruft, auch wenn mir die Argumentation von den »präzendenzlosen Besonderheiten« 10 der Schoa am ehesten einleuchtet. Mein Blickwinkel ist auch emotional und ich halte das für legitim. Als Gesellschaft sollten wir darum ringen, dass es weiter ein gemeinsames identitätsstiftendes Gedenken an die Schoa gibt, bei dem das »Wer« eben nicht ausschlaggebend ist. Hier wünsche ich mir, dass in gewissem Maße mein Magistervater Recht behält: ob jüdisch, nichtjüdisch, migrantisch oder welcher Hintergrund auch immer im diversen Deutschland – dies sollte keine Rolle spielen, alle können und sollen an der Erinnerung an die Schoa teilhaben; entsprechende Vermittlungskonzepte gibt es zur Genüge. Ein solches Agreement bedeutet Einschluss, aber auch Forderung. Gleichzeitig dürfen andere Opfergruppen keine Zaungäste bleiben. Natürlich kam konkret insbesondere die Erinnerung an die Kolonialverbrechen auf skandalöse Weise bisher viel zu kurz! Wann hatte ich erstmals vom Genozid an den Herero und Nama gehört? Und wann gelesen, dass zur Zeit der Nürnberger Prozesse massive rassistische Menschenrechtsverletzungen durch die Ankläger geschahen, dass der Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte hier also nicht galt? (Zu) Spät.
Für Einschlüsse und gegen Antithesen der Erinnerung
Die Haltung, den Schmerz der Anderen begreifen zu wollen, 11 finde ich wichtig. Anerkennung und Empathie sollten nicht nur selbstverständlich sein, ich sehe einen Anspruch darauf. Doch es kann nicht darum gehen, dass die »neuen« Anderen die bisherigen Anderen verdrängen. In unserer Ausstellung »Ende der Zeitzeugenschaft?« stellten wir explizit die Frage, wie »dem Grundsatz der Diversität auch in den Erinnerungskulturen Rechnung getragen werden [kann], ohne Konkurrenzen zu verstärken«, wie Solidarität gefördert werden könne. Ich gebe eine simple Antwort: Wenn Diversität so verstanden wird, bisher marginalisierte Erinnerungen nun als eine Art dialektische Antithese in den Vordergrund bringen zu wollen, so ist dies ein ziemlich sicheres Rezept dafür, Konkurrenzen zu verstärken. Damit wächst nicht nur innerhalb der jüdischen Community die Befürchtung, dass um längst und schwer Ausgehandeltes nun wieder gefochten werden muss. Dass durch andere Erinnerungserzählungen die Schoa weggedrängt und weniger wichtig wird. Dass Rechte und radikale Postkolonialisten Erfolg haben mit Relativierungstendenzen. Wie schwer ist es, da Erfahrungs- und Gefühlswelten zu verstehen? Statt einer Antithese braucht es jetzt eine kommunikativ gut eingeführte, sensible Synthese. Gewarnt sei vor einem Kampf ums Zentrum der Erinnerung. Dabei ist klar, dass bei den verschiedenen Opfergruppen auch Status und Ressourcen eine Rolle spielen – wie könnte es anders sein? Hier sind Gesellschaft und staatliche Akteur: innen gefragt, die sich die Frage stellen sollten, was sie alles dazu tun können, damit Opfergruppen nicht im Sinne einer Aufmerksamkeitsökonomie denken (müssen) und Konkurrenzen empfinden. Vieles ist weiter auszutarieren um das umworbene kollektive Gedächtnis. Differenzen werden bleiben, neue Herausforderungen sich ergeben. Ist es realistisch, dass die Dynamik so funktionieren kann, wie Michael Rothbergs Vorstellung einer »multidirektionalen Erinnerung«¹² es will: dass Erinnerungen an verschiedene Opfergruppen sich gegenseitig nur verstärken, befruchten und nicht konkurrieren, dass die Erinnerungsräume mit ihnen wachsen? Es gibt immerhin manche Kooperation zwischen jüdischen und beispielsweise migrantischen Communities. Werden sogar neue Bündnisse entstehen? Vielleicht. Jedenfalls ist dies zu hoffen.
Der Beitrag erschien in: Jüdischer Almanach. Umbrüche Neues und Altes aus der Jüdischen Welt, hg. von Gisela Dachs, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin 2023