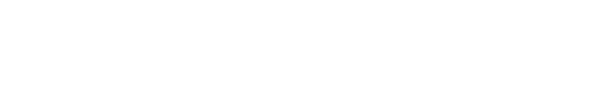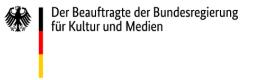Was stehen blieb Zerstörte Synagogen im Berlin der Nachkriegszeit
- 28.04.2014 - 31.08.2014
kuratiert von Diana Schulle,
Leitung Dr. Hermann Simon, Dr. Chana Schütz
Diana Schulle
Was stehen blieb
Mehr als 55.000 Berliner fielen dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer. Nach der Befreiung sammeln sich die wenigen Überlebenden um die zerstörten Synagogen der Stadt, wo zaghaft wieder jüdisches Leben beginnt. Doch kaum jemand kann sich vorstellen, dass auch nur einer dieser befreiten jüdischen Menschen in der Stadt bleiben würde, in der der millionenfache Massenmord organisiert wurde. Jeder einzelne hat Verwandte und Freunde verloren, viele sind die einzigen, die aus ihren Familien noch am Leben sind.
Am 11. Februar 1946 wird die Jüdische Gemeinde zu Berlin vom Magistrat von Groß-Berlin als Körperschaft öffentlichen Rechts wieder anerkannt. Sie wird allerdings nicht an den Ende 1947 beginnenden Restitutionsverhandlungen beteiligt. Alle Personen, die nach den „Nürnberger Gesetzen“ als Juden galten, waren zwangsweise in die „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ eingegliedert worden, ebenso die jüdischen Gemeinden, die ihr Vermögen abzugeben hatten.
Diana Schulle
Was stehen blieb
Da die „Reichsvereinigung“ seit Sommer 1939 unter der Kontrolle der Gestapo stand und deren Anordnungen umzusetzen hatte, sehen die Besatzungsmächte in den Nachkriegsjahren in ihr noch immer eine nationalsozialistische Organisation. Vergeblich bemüht sich die Berliner Jüdische Gemeinde in der frühen Nachkriegszeit darum, einen Teil der Entschädigungszahlungen zum Wiederaufbau jüdischen Lebens in Deutschland verwenden zu können.
Diese Gelder fließen zu dieser Zeit ausschließlich an internationale jüdische Organisationen. Seit Mitte der 1950er Jahre werden viele Synagogengrundstücke beräumt, Ruinen gesprengt und noch existierende Gebäudeteile abgetragen, um vor allem den dringend notwendigen Wohnraum zu schaffen. Erst in diesen Jahren verschwinden viele Spuren einstigen jüdischen Lebens aus dem Berliner Stadtbild. Allein die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße bleibt bis 1988 als Ruine, und damit als Mahnmal, erhalten
Was stehen blieb –
Zerstörte Synagogen im Berlin der Nachkriegszeit
Die Ausstellung spannt den Bogen von den Zerstörungen des 9. Novembers 1938 bis in die 1950er Jahre und zeigt eine Vielzahl zerstörter Synagogen, die noch lange nach Kriegsende das Stadtbild Berlins prägten, bis sie dem modernen Wiederaufbau der Stadt weichen mussten. Die Ausstellung zeigt auch, dass die wiedervereinigte Berliner Jüdische Gemeinde bewusst in die traditionelle Mitte Berlins, in die Oranienburger Straße zurückgekehrt ist.
Synagoge Levetzowstraße
Der Entwurf für eine der größten Berliner Synagogen stammt von dem Architekten Johann Höniger, der zuvor bereits die Synagogen in der Artilleriestraße und in der Rykestraße konzipiert hatte. Der Neubau ist notwendig geworden, denn in Moabit und vor allem im Hansaviertel wohnen viele Juden und es fehlen Synagogenplätze. Am 7. April 1914 wird die Synagoge nach liberalem Ritus eingeweiht. Dem wuchtigen Großbau an einer stark belebten Kreuzung sind eine Religionsschule und Gemeindewohnungen angeschlossen.
In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wird die Synagoge nur geringfügig beschädigt. Im Oktober 1941 wird die Jüdische Gemeinde gezwungen, die Synagoge als Sammellager für die Massendeportationen einzurichten. Vom 18. Oktober 1941 bis Mitte April 1942 werden ca. 12.000 Berliner Juden hier erfasst, um in die Ghettos von Litzmannstadt (Lodz), Minsk, Kowno, Riga, Piaski und Warschau deportiert zu werden. Vom Sammellager in der Levetzowstraße aus müssen bis Ende Januar 1942 wenigstens 10.000 Juden die etwa acht Kilometer lange Strecke zum Bahnhof Berlin-Grunewald zu Fuß laufen. Später tritt der näher gelegene Güterbahnhof Putlitzstraße an die Stelle des Bahnhofs Grunewald. Ab Juni 1942 übernimmt das geräumte Altersheim der Jüdischen Gemeinde in der Großen Hamburger Straße 26 die Funktion des Sammellagers.
Während des Krieges schwer zerstört, wird die Ruine der Synagoge in der Levetzowstraße 1955 wegen Einsturzgefahr gesprengt. 1960 entsteht eine kleine Gedenkstätte; am 14. November 1988 wird ein Mahnmal mit einem Eisenbahnwaggon und einer Eisentafel mit den Zielen der Deportationen eingeweiht.
Synagoge Johannisstraße
Im Zusammenhang mit dem Aufschwung liberaler und progressiver Ideen vor der Märzrevolution 1848 artikuliert sich auch innerhalb der Berliner Jüdischen Gemeinde das Bestreben, den jüdischen Gottesdienst zu reformieren. Eine “Genossenschaft zur Reform des Judentums” mit etwa 700 Mitgliedern wird gegründet, die 1846 einen provisorischen Gebetsraum einrichtet, um einen reformierten Gottesdienst abhalten zu können. Acht Jahre später, am 10. September 1854, wird in der Johannisstraße 11a (damalige Zählung) die Synagoge der Reformgemeinde eingeweiht.
Die prägnanteste Neuerung ist die Verlegung des Gottesdienstes auf den Sonntag und die Verwendung der deutschen Sprache für fast alle Gebete. Kopfbedeckung und Gebetsmantel werden abgeschafft, Orgelbegleitung und gemischter Chorgesang eingeführt, sowie die räumliche Trennung von Männern und Frauen aufgehoben. Aus dem Gebetbuch werden alle Passagen gestrichen, die eine Rückkehr nach Palästina beinhalten.
Die Synagoge ist nach Plänen von Friedrich Gustav Alexander Stier erbaut worden. Der repräsentative Bau mit zwei Seitenflügeln für Gemeindeverwaltung und Schule bleibt 84 Jahre die Heimat der Berliner jüdischen Reformgemeinde. Im November 1938 wird das Innere der Synagoge stark demoliert. Bis April 1940 wird der Gebetsraum wieder instand gesetzt und dient bis Mitte 1942 als Ersatz für die geschlossene Neue Synagoge in der Oranienburger Straße.
Die Synagoge und das Verwaltungsgebäude der Reformgemeinde werden im Zweiten Weltkrieg zerstört und die Ruine später abgetragen. Auf dem Grundstück befindet sich heute ein Parkplatz.
Synagoge Prinzregentenstraße
Bereits 1913 erwirbt die Jüdische Gemeinde Berlin das Grundstück an der Prinzregentenstraße, um hier eine Synagoge zu errichten. Doch über 15 Jahre vergehen, bis zwischen 1928 und 1930 ein runder, überkuppelter Zentralbau nach den Plänen des Gemeindebaumeisters Alexander Beer entsteht. Die Form wird gewählt, da sich nur so bei gleicher Grundfläche die notwendigen Abstände zu den Nachbargebäuden einhalten lassen, aber auch um in einem runden Gebetsaal das Gemeinschaftsgefühl der Beter zu stärken, die sich im Laufe der 1920er Jahre immer mehr als jüdische Schicksalsgemeinschaft verstehen.
Die Synagoge wird am 16. September 1930 geweiht. Die bisherige in den Synagogen übliche Trennung zwischen Männern und Frauen ist aufgehoben und der Gottesdienst wird durch eine Orgel begleitet.
Am 9. November 1938 wird die freistehende Synagoge in Brand gesetzt. Das Dach ist beschädigt und Teile des Gemäuers drohen einzustürzen, sodass der Gehweg gesperrt werden muss. Die Jüdische Gemeinde wird aufgefordert, für den entstandenen Schaden selbst aufzukommen, wobei Gemeindebaumeister Beer den teilweisen Abriss seines von ihm geschaffenen Bauwerks leiten muss. 1941wird die Jüdische Gemeinde gezwungen, die Synagogenruine für ein Zehntel des Wertes an die Stadt Berlin zu verkaufen, die es 1956 durch ein Rückerstattungsverfahren legal erwirbt.
Unter großen technischen Schwierigkeiten wird 1958 die Ruine abgetragen. Anschließend überlässt die Stadt das Gelände dem Allgemeinen Blindenverein Berlin, der hier 1959 blindengerechte Wohnungen errichtet.
Synagoge Lippmann – Tauß
Im Jahre 1776 gegründet, reichen die Wurzeln der Lippmann-Tauß-Synagoge bis zur Anfangszeit der Berliner Jüdischen Gemeinde zurück, als die aus Wien vertriebenen Juden im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts hier sesshaft werden. Unter den Ankommenden befinden sich Mitglieder einer Familie Wulff -Thaussick. 1803 wird Lippmann Taussik zum Ältesten der Berliner Jüdischen Gemeinde gewählt.
Betstuben und Synagogen bestehen zu dieser Zeit nur auf privater Basis, weil die Zahl der Juden in Friedrichshain gering ist. Doch sie nimmt zu, weshalb die Lippmann-Tauß-Synagoge mehrfach ihren Standort wechselt. Schließlich findet sie 1893 ihren Sitz im Hof der Gollnowstraße 12, in der Nähe des Alexanderplatzes. In einem alten Fabrikgebäude pflegt diese von der Jüdischen Gemeinde subventionierte Privatsynagoge mit etwa 250 Mitgliedern den orthodoxen Ritus. 45 Jahre später wird sie während des Pogroms im November 1938 verwüstet. Der Synagogenverein findet einige Häuser weiter, in der Friedenstraße 3, neue Räume, bis sie zwangsweise geschlossen wird. 1950 wird das im Krieg zerstörte Gebäude in der Gollnowstraße 12 abgerissen; durch die neue Straßenführung ist sie aus dem Stadtbild verschwunden.
Seit 1988 erinnert eine Gedenktafel an die Synagoge, gestiftet von den Geschwistern Elisabeth Beare und Reinhold Becker, Nachkommen der Familien Meyer und Wulff. Nach andauernden Graffiti-Beschmierungen wird die Tafel im März 2003 abgenommen und dem Berliner Stadtmuseum zur Aufbewahrung übergeben. Heute erinnert eine Gedenktafel am Haus Friedenstraße 3 an den letzten Rabbiner Dr. Felix Singermann und die ab 1940 im zweiten und dritten Stock befindliche Unterkunft für hilfsbedürftige alte Leute.
In Kooperation mit


Bild 1: Intro Ausstellung (c) CJ_Anna Fischer
Bild 2: Blick in die Ausstellung(c) CJ_Anna Fischer
Bild 3: Blick in die Ausstellung(c) CJ_Anna Fischer
“Was stehen blieb. Synagogen im Berlin der Nachkriegszeit”
Eine Ausstellung der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum
im Rahmen des Themenjahres “Zerstörte Vielfalt”
Gesamtleitung
Hermann Simon, Chana Schütz
Konzept und Texte
Diana Schulle
Grafische Gestaltung
Tina Raccah, Berlin
Projektkoordination
Anna Fischer,
Bildredaktion
Anna Fischer, Diana Schulle
Aufbau und Druck
form art Berlin