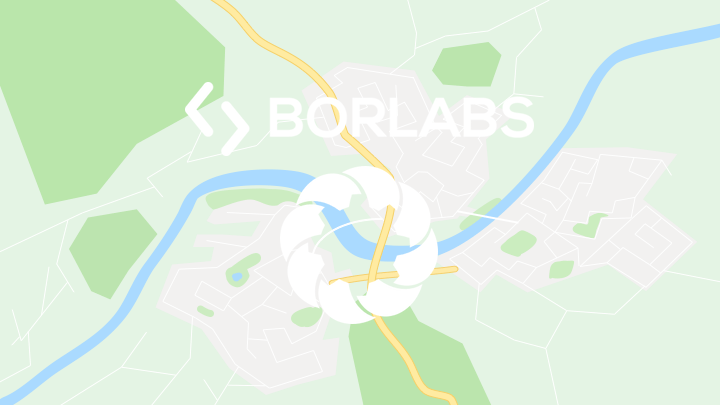Polizeigewalt im Scheunenviertel
Matthea Kiesant, Studierende der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Das Scheunenviertel entfaltete sich im frühen 20. Jahrhundert nicht nur als Ort politischer Unruhen, sondern auch als Brennpunkt sozialer Probleme. Eine Vielzahl von Themen wie linke Versammlungen, wachsende Armut und der Aufstieg des illegalen Handels verschmolzen in dieser Umgebung. Die Spartakisten und die spätere Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) fanden hier eine Bühne für ihre Revolutionsversuche, während das Viertel zugleich von zunehmender sozioökonomischer Benachteiligung geprägt war, was zur Entstehung inoffizieller wirtschaftlicher Strukturen führte. Beispielsweise befanden sich wichtige linke Versammlungsorte im Scheunenviertel oder in unmittelbarer Nähe, wie das Handwerkervereinshaus in der Sophienstraße oder die Parteizentrale der KPD, die sich zunächst in der Rosenthaler Straße und ab 1926 hier im Karl-Liebknecht-Haus befand.
Während des Ersten Weltkriegs versuchte die Regierung den Handel zu regulieren, doch nach Kriegsende breitete sich der illegale Handel weiter aus. Die Polizei änderte ihre Strategien und konzentrierte sich zunehmend auf die Kontrolle der Orte, an denen der Straßenhandel florierte. Diese Kontrollen richteten sich verstärkt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere gegen jüdische Migrant:innen aus Osteuropa. Trotz intensiver Polizeipräsenz blieben die Straßenhändler:innen mobil und fanden immer wieder neue Wege, ihren Handel zu betreiben. Eine der ersten, groß angelegten Polizeirazzien am 14. April 1919, richtete sich gegen die Straßenhändler*innen im Scheunenviertel. Schwer bewaffnete Polizei- und Militärtruppen zogen Stacheldraht über die Straßen des Scheunenviertels und sperrten die Menschenmassen ein. Etwa 300 Soldaten rückten zusätzlich an. Am nächsten Tag schrieben die Zeitungen von Zusammenstößen, bei denen ein Soldat, zwei Arbeiter und ein Bäcker getötet wurden. Viele andere erlitten Schusswunden. Die Truppen luden sechzig Personen auf Lastwagen und fuhren zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz, wo sie verhört wurden.
Insbesondere
in der Grenadierstraße (heute Almstadtstraße) erlebte das jüdische Leben einen
Aufschwung mit zahlreichen Geschäften, Pensionen und Betstuben. Jedoch wurden
die jüdischen Bewohner:innen regelmäßig Opfer rassistischer und antisemitischer
Razzien, verstärkt durch eine negative Darstellung in den Medien und politische
Diskurse. Diese Razzien dienten dazu, die jüdischen Bewohner:innen als Störfaktoren im Viertel zu
konstruieren und trugen maßgeblich dazu bei, dass das Scheunenviertel von
weiten Teilen der Bevölkerung als “kriminell” wahrgenommen wurde.
Diese rassistischen Polizeikontrollen verstärkten die Vorstellung, dass
jüdische Migrant:innen aufgrund vorgefasster Vorurteile keinen Platz in der
Gesellschaft haben sollten, und machten das Scheunenviertel zu einem
symbolischen Ort für die preußische Migrationspolitik.
Bereits Ende
des 19. Jahrhunderts spielte der Antisemitismus der Anwohner:innen eine
entscheidende Rolle, wie aus zahlreichen Petitionen an die Berliner
Stadtverordnetenversammlung hervorgeht. Einige dieser Petitionen zielten darauf
ab, arme, migrantische und jüdische Bewohner:innen aus dem Viertel zu
verdrängen. Diese tief verwurzelten Vorurteile boten den idealen Nährboden für
antisemitische Agitatoren, die am 5. November 1923 genügend Menschen
mobilisierten, um ein Pogrom gegen die jüdischen Migrant:innen im
Scheunenviertel zu verüben.
Folgende Berichte aus dem Jahr 1920 zeigen deutlich, dass es bei den
Polizeirazzien längst nicht mehr nur um illegalen Straßenhandel ging. Auch wenn
einige der Razzien, noch im Namen des Kampfes gegen den sogenannten „wilden
Straßenhandel“ stattfanden, stellte sich die Realität anders dar:
Am 13. Februar 2020 schreibt die SPD-Parteizeitung Vorwärts über eine
Razzia, die am Tag zuvor im Scheunenviertel stattgefunden hatte: „Alle
Personen, die sich nicht ausweisen konnten, wurden festgenommen.“[1]
Am 17. Februar 1920 blockiert die Polizei die Ausgänge der
Grenadierstraße und kontrolliert die Ausweispapiere der Menschen, die durchsucht, verhaftet und in Barracken interniert werden.[1]
Am 20. Februar 1920 lässt der Berliner Polizeipräsident im Scheunenviertel eine großangelegte Razzia durchführen, bei der vorläufig 700 Personen festgenommen werden.[2]
Am 26.02.1920 schreibt der Vorwärts: „Eine erneute Razzia im
Scheunenviertel wurde gestern mittag von der Sicherheitspolizei vorgenommen. Sämtliche Häuser in der Grenadierstraße wurden umstellt und durchsucht, und 700 Personen mußten den Weg zur Alexanderkaserne antreten, wo sie sich einer Leibesuntersuchung unterziehen mußten.“[3]

Anfang März 1920 werden weitere 300 Personen verhaftet für illegalen Straßenhandel, weil sie sich nicht ausweisen konnten oder „anderweitig
verdächtig waren“.[4]
27 März 1920: Unter Anwendung des Kriegsrechtes rief General von Seeckt zur Festnahme aller Personen auf, die eines Verbrechens verdächtigt wurden oder sich nicht ausweisen konnten. In vielen deutschen Zeitungen wurde diese Razzia, als „Maßnahme gegen lästige Ausländer“ dargestellt. Gemeinsam nahmen Militär und Polizei etwa 1000 Menschen fest, darunter auch Frauen und Kinder. Etwa 300 Personen wurden anschließend ohne Gerichtsverfahren im Internierungslager Wünsdorf-Zossen untergebracht. Das sogenannte Halbmondlager hatte während des Ersten Weltkriegs als Kriegsgefangenenlager muslimischer Soldaten gedient. Diese willkürliche Internierung der Menschen avancierte zu einem politischen Skandal und das jüdische Arbeiterfürsorgeamt (AFA) mischte sich ein. Da die Anschuldigungen der Polizei nicht nachgewiesen werden konnten, wurden schließlich die meisten jüdischen Gefangenen nach wenigen Tagen wieder freigelassen, was allerdings nicht das Ende der Internierungspolitik bedeutete.[5]
[1] Molly Loberg: The Struggle for the Streets of Berlin. Politics, Consumption, and Urban Space 1914–1945. Cambridge 2018, p. 94.
[2]
Anne-Christine Sass: Berliner Luftmenschen. Osteuropäisch-jüdische Migranten in der Weimarer Republik. Wallstein Verlag, 2012, S. 364.
[3] 26.02.1920: Grenadierstraße. In: Vorwärts, S.3.
[4] Loberg 2018, p. 95.
[5] Sass 2012, S. 364.
Teilen